Am 5. Juli 2016 starb, im 95. Lebensjahr, die Widerstandskämpferin
Helene Neuhaus,
die viele Jahre als ehrenamtliche Mitarbeiterin des DÖW tätig war und die ins Dokumentationsarchiv kommenden Schulklassen mit ihren Erzählungen aus dem Widerstand faszinierte. Auch danach blieb sie eine gefragte Zeitzeugin und hat sich, gemeinsam mit Paul Vodicka, für die Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die kampflose Befreiung Ottakrings im April 1945 engagiert.
 (Helli Neuhaus bei der Eröffnung des Denkmals "Sandleitendatenbank" in Wien-Ottakring am 21. Oktober 2015, Foto: Winfried R. Garscha)
(Helli Neuhaus bei der Eröffnung des Denkmals "Sandleitendatenbank" in Wien-Ottakring am 21. Oktober 2015, Foto: Winfried R. Garscha)
Helli wurde am 22. Februar 1922 als siebentes und letztes Kind des Ottakringer Ehepaares Hubert und Stefanie Arent geboren; fünf ihrer Geschwister waren zum Zeitpunkt ihrer Geburt schon gestorben – Geld für einen Arzt gab es nicht. Der sozialdemokratische Vater und die tiefkatholische Mutter hatten vor allem eines gemeinsam: Die Abscheu vor Krieg und Gewalt. Die Berichte des Vaters über die Gräuel des Ersten Weltkriegs prägten Helli von Kindheit an und machten sie zur überzeugten Kriegsgegnerin. Helli lernte früh, ihren Willen durchzusetzen – und erreichte beispielsweise, dass ihre Mutter zustimmte, dass sie von der Klosterschule in eine normale Volksschule des Roten Wien wechseln und am Nachmittag den "Hort" besuchen durfte, wo die Kinder Völkerball spielen konnten. Außerdem gab es Kinonachmittage und wurden fortschrittliche Bücher vorgelesen, beispielsweise den Roman Kleiner Mann – was nun? von Hans Fallada.
Helli begann eine Lehre als Modistin. Zunächst bei den Roten Falken aktiv, schloss sie sich bereits 1936, als 14-Jährige, dem Kommunistischen Jugendverband in Ottakring an. Damals wurde sie auch zum ersten Mal von der Polizei verhaftet. Im Widerstand lernte sie ihren ersten Ehemann, Hans Kurzbauer, kennen. Mit 20 brachte sie ihr erstes Kind, Hans, zur Welt. Ab 1943 war sie – gemeinsam mit Franz und Friederika Burda – in der von Karl Hudomalj geleiteten überparteilichen Anti-Hitler-Bewegung Österreichs aktiv. Ab Mitte 1944 beteiligte sie sich in Ottakring am Wiederaufbau des in den Jahren zuvor von der Gestapo zerschlagenen Kommunistischen Jugendverbands Österreichs. Unter der Bezeichnung "KJV 1944" hatten der Sanitätsunteroffizier Heini Klein und einige weitere unentdeckt gebliebene Mitglieder des illegalen KJV begonnen, sich auf die zu erwartenden Kämpfe in der Endphase des NS-Regimes vorzubereiten, und schließlich eine Organisation mit rund 80 Mitgliedern geschaffen.
Als der Gruppe durch ihre Kontakte zur Widerstandsorganisation im Wehrkreiskommando XVII klar wurde, dass die Rote Armee Wien vom Westen her angreifen würde, begann sie mit jener Aktion, die NS-Propagandaminister Goebbels zu einer wütenden Eintragung in seinem Tagebuch veranlasste und die Wehrmachtsführung zur Einschätzung gelangen ließ, Teile der Wiener Bevölkerung hätten "die Haltung verloren". Heini Klein hatte – als angeblicher Wehrmachtskurier – einen gefälschten Befehl von Gauleiter Baldur von Schirach zur Kampfleitstelle auf der Sophienalpe gebracht. Darin wurde angeordnet, die Hauptkampflinie vom Wienerwald zum Gürtel zu verlegen. In der Zwischenzeit hatten einige Jugendliche, unter ihnen Helli, eine Spinnstoffsammlung der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt gegenüber dem Sandleitenkino aufgebrochen und daraus jene Zivilkleider entnommen, die sie den Soldaten und Mitgliedern des Volkssturms im Tausch gegen ihre Gewehre anboten. Helli berichtete, sie hätten den Männern gesagt: "Bei uns wird nicht gekämpft. Der Krieg ist aus, versteckt's euch in den Kellern."
Helli wirkte am Aufbau der Freien Österreichischen Jugend mit, wo sie den aus dem schwedischen Exil nach Österreich zurückgekehrten Walter Neuhaus kennenlernte, nachdem sie sich zuvor trotz der unsicheren Zukunft als Mutter eines dreijährigen Kindes von ihrem ersten Mann getrennt hatte. 1947 heirateten die beiden, 1948 wurde die Tochter Eva geboren. Helli machte eine Ausbildung zur Buchhalterin und Lohnverrechnerin, arbeitete zunächst für den Weltgewerkschaftsbund, dann in verschiedenen Firmen und schließlich, bis zu ihrer Pensionierung, bei der Garant Versicherung. Jahrzehntelang war sie auch gewerkschaftlich tätig und wurde in den Betriebsrat der Firmen, in denen sie arbeitete, gewählt. 1968 trat sie aus der Kommunistischen Partei aus, blieb aber Mitglied des KZ-Verbands; gleichzeitig wurde sie im Bund der Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen aktiv.
Auf der "Sandleiten-Datenbank" auf dem Matteottiplatz in Ottakring, neben der von Helene Neuhaus mitinitiierten Gedenktafel für Heini Klein, kann man mittels Kopfhörer Hellis Schilderung der Ereignisse des 7. April 1945 anhören, die 2015 von "Wohnpartner Wien" für "Soho in Ottakring" aufgenommen wurde.
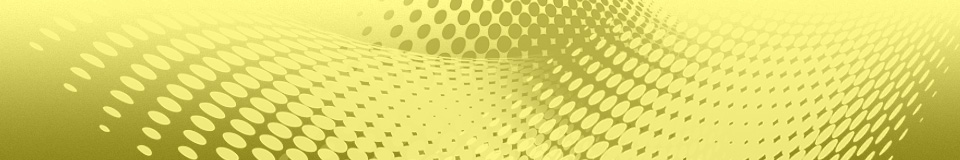
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)










.jpg)
.jpg)









.jpg)
.jpg)






















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






































.jpg)

.jpg)


